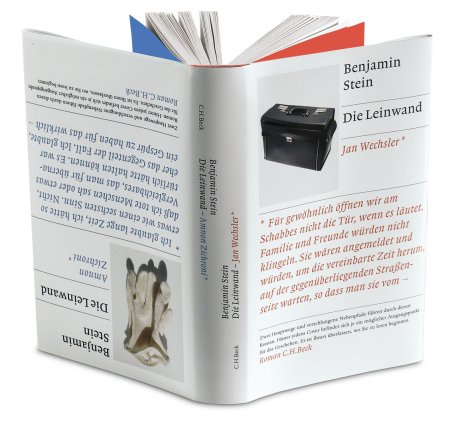Der in den letzten Wochen mit großem Erfolg in
den deutschen Kinos gelaufene gleichnamige Film war zweifelsohne sehenswert. Denn
in diesem Fall kam das alte Klischee
nicht gänzlich zur Geltung, wonach die Verfilmung eines Romans oft hinter dem
Buch selbst zurücksteht(was in diesem Fall natürlich auch an den wunderschönen
Schauspielern lag). Dennoch hat die
Lektüre desselben mindestens einen großen Vorteil: Man kann die Briefe und
Gedanken, die der Arzt Amadeu de Prado während der Diktatur in Portugal verfasste,
in aller Ruhe mehrfach lesen, genießen und darüber in Stille sinnieren. Wie
sollte das im, zugegebenermaßen, sehr schönen und ästhetischen Film möglich
sein?
Und allein schon diese melancholischen,
zutiefst ehrlichen und extrem selbstkritischen Gedanken dieses
außergewöhnlichen Mannes machen das Buch so wertvoll. Wann hat jemals schon ein
Mensch so schonungslos offen mit sich und der ihn umgebenden Welt abgerechnet
ohne anklagend zu werden?
Aber auch der Rahmen der Handlung stimmt
nachdenklich und zugleich hoffnungsvoll für das eigene Leben: Da wird ein den
alten Sprachen verfallener, hochintelligenter und von seinen Schülern
geliebter, jedoch von seiner Frau vor vielen Jahren ob seiner offensichtlichen
Langweiligkeit verlassener Lehrer von einer Sekunde auf die andere aus seinem
gewohnten Trott gerissen. Eine junge Portugiesin hält er vom todbringenden
Sprung von einer hohen Brücke ab, diese begleitet ihn darauf hin bis ins
Klassenzimmer, worauf Raimund Gregorius, von der portugiesischen Aussprache der
Frau hingerissen, ohne Nachzudenken sein Leben von einem Augenblick auf den
anderen ändert: Er verlässt mitten im Unterricht seine verdutzten Schüler und
die gewohnte Schule, seinen Alltag und seine Welt. Durch Zufall fällt ihm in
einer Buchhandlung das Buch eines portugiesischen Autors in die Hände und nun
gibt es für ihn nur noch eines: Diesen Mann aufspüren. Also nimmt Gregorius den
nächsten Zug über die französische in die portugiesische Hauptstadt, lernt auf
der Fahrt einen gehetzten aber sehr sympathischen Lissabonner Geschäftsmann
kennen und quartiert sich in einem kleinen Hotel in der Altstadt ein. Von einem
unsichtbaren Sog getrieben, streunt er durch die Straßen der Stadt, lernt in
kürzester Zeit mehr Menschen kennen (im wortwörtlichen Sinne) als in den vielen
Jahren in Bern und kommt Amadeu mit jedem Tag, den er sich von seinem eigenen
Leben entfernt, ein ganzes Stück näher. Immer tiefer taucht er in dessen Welt
ein, auch wenn seine erste Begegnung mit dem Portugiesen, dem er sich auf
seltsame Weise zutiefst verbunden fühlt, die mit dessen Grabstein ist. Doch
zwei Schwestern und zwei ehemals sehr enge Freunde leben noch, ebenso wie zwei
ehemalige Freundinnen, und diese Menschen erzählen Gregorius immer mehr Details
über den geheimnisvollen Mann, dessen Familie und die Gründe, warum er in der
Resistance sein Leben riskierte. Die Menschen fassen Vertrauen zu dem Schweizer
Lehrer, kehren in ihre längst verdrängte Vergangenheit zurück und händigen ihm
verschiedene Briefe aus, mit deren Hilfe sich Gregorius ein immer genaueres
Bild über das Leben und den inneren Gemütszustand seines Bruders im Geiste
verschaffen kann und die ihn durch deren teilweise philosophischen
Betrachtungen begeistern. Genau wie den neugierigen, suchenden Leser.
Hier werden Fragen aufgeworfen, die uns alle
hin und wieder quälen, wie z.B.: „Wie
unterscheidet man, ob man eine Empfindung wichtig nehmen oder sie wie eine
leichtgewichtige Laune behandeln soll?“
Und wer kennt nicht diesen so logisch
daherkommenden Ratschlag, man solle:„Den
Augenblick leben. Es klingt so richtig und auch so schön …, aber je mehr ich es
mir wünsche, desto weniger verstehe ich, was es heißt.“ ?
Gregorius, auch von dessen Zweifeln und Gedanken
kann man immer wieder lesen, wusste stets, und diese These hatte er immer
vehement verteidigt, dass man Menschen ganz einfach in zwei Klassen einteilen
kann, die Leser und die Nichtleser. Und dass es keinen größeren Unterschied
zwischen Menschen gibt als eben diesen. Denn wer liest, trägt Fragen in sich
und wenn er auch selten eine eindeutige Antwort bekommen mag, so trägt doch
jedes Buch dazu bei, sich selbst besser verstehen zu lernen.
Die Reise in die fremde Stadt und in das Leben
der dortigen Menschen führt auch in Gregorius zu selbstreflektierenden
Betrachtungen seines eigenen Lebens, der Möglichkeiten, die ihm dieses bot und zu
Überlegungen, wie dieses hätte verlaufen können, wenn bestimmte Entscheidungen
anders gefällt worden wären. Auf der Suche nach Amadeu fragte er sich, ob es
möglich sei: „…dass der beste Weg, sich
seiner selbst zu vergewissern, darin bestand, einen anderen kennen und
verstehen zu lernen?“
Einer der Höhepunkte des Buches ist ganz
sicherlich die Abschlussrede des in einer religiösen Umgebung aufgewachsenen
Amadeu am Ende seiner Schulzeit. Hier greift der Sohn eines offensichtlich von
der Diktatur profitierenden Richters (später werden auch die Gründe hierfür
näher beleuchtet – und wieder kann man lernen, dass es immer Gründe für unser
Tun oder eben Nichttun gibt, auch wenn sie den Mitmenschen nicht bekannt sind)
nicht nur das Regime an. Er, der Kathedralen und betende Menschen liebt,
rechnet in einer Art und Weise mit Gott ab, die einen schwindlig machen kann. Der
blutjunge Amadeu vergleicht die Allwissenheit Gottes, der jeden unserer
Schritte und all unsere Gedanken kennt, mit der Brutalität der Folter, die den
Inhaftierten ihren Rückzug nach innen durch Helligkeit und Schlafentzug
vorenthält, was ihnen die Seele stiehlt: „Sie
zerstört die Einsamkeit mit uns selbst, die wir brauchen, wie die Luft zum
Atmen.“ Und er hinterfragt in seiner Rede die auch von Nichtchristen mitunter
erhofften Versprechen der Ewigkeit, in dem er grandios schlussfolgert, dass
diese schal und langweilig wäre, weil es vor dem Hintergrund eines ewigen
Lebens keine Rolle spielte, was heute passiert: „Millionenfache Versäumnisse würden vor der Ewigkeit zu einem Nichts,
und es hätte keinen Sinn, etwas zu bedauern, denn es bliebe immer Zeit, es
nachzuholen. Nicht einmal in den Tag hineinleben könnten wir, denn dieses Glück
zehrt vom Bewusstsein der verrinnenden Zeit, der Müßiggänger ist ein Abenteurer
im Angesicht des Todes… Wenn immer und überall Zeit für alles und jedes ist: Wo
sollte da noch Raum sein für die Freude an Zeitverschwendung?“
Obwohl Amadeu selbst aus berechtigtem Grund in
ständiger Angst vor seinem bevorstehenden Tod lebte, reflektiert er über die
Gründe, warum seine Patienten so entsetzt waren, wenn er diesen ankündigte,
dass sie nicht mehr lange zu leben hätten und nimmt dem Leser gleichzeitig die Angst
vor seinem eigenen Sterben: „Sie wollen
nicht, dass es zu Ende sei, auch wenn sie das fehlende Leben nicht mehr
vermissen können – und das wissen.“
Auch das Thema Einsamkeit teilen beide Männer.
Und so liest Gregorius immer wieder die Aufzeichnungen des Portugiesen, der
sich dieser Angelegenheit kurz vor seinem Tod, welcher ihn recht früh ereilte,
intensiv widmete. Er meinte, dass wir Menschen unfrei wären und Sklaven unserer
Umgebung, und er kämpfte mit Worten und Gedanken dagegen an: „Wenn uns die anderen Zuneigung, Achtung und Anerkennung entziehen:
Warum können wir nicht einfach zu ihnen sagen: Ich brauche das alles nicht, ich
genüge mir selbst?“
An anderer Stelle fragt er sich, „… ob wir nur aus Angst vor Einsamkeit so
selten sagen, was wir denken? Weshalb sonst halten wir an all diesen zerrütteten
Ehen, verlogenen Freundschaften …fest?“ Und dann erfasst Amadeu das Wesen
der Einsamkeit einmal aus einem ganz anderen, positiven Blickwinkel, in dem er
fragt, worin diese eigentlich bestehe: „In
der Stille ausbleibender Vorhaltungen? In der fehlenden Notwendigkeit, mit
angehaltenem Atem über das Minenfeld ehelicher Lügen … zu schleichen? In der
Freiheit, beim Essen niemanden gegenüberzuhaben?“
Brillant ist dann die Schlussfolgerung, die
das Potenzial in sich trägt, für viele dieser Ängstlichen ein Tor zu öffnen und
damit eine Möglichkeit aufzeigt, die wohl kaum jemand schon so treffend
formuliert hat:
„Und
warum sind wir eigentlich so sicher, dass uns die anderen nicht beneideten,
wenn sie sähen, wie groß unsere Freiheit geworden ist? Und dass sie nicht
daraufhin unsere Gesellschaft suchten?“
„Nachtzug nach Lissabon“ ist kein Reiseführer
der schönen alten Stadt an der Mündung des Tejo – aber das Buch macht Lust auf eine
Reise dorthin. Es ist ein Mut machendes Buch, auch wenn viele der Gedanken
ausgesprochen düster daherkommen. Denn zugleich vermag es uns Ängste zu nehmen
(vor der Einsamkeit, vor dem Tod, vor der Fremde) und es regt unsere Gedanken
an, es lädt ein, auch unser Leben zu überdenken und zeigt, dass es niemals zu
spät ist, etwas zu verändern, spannende Menschen und neue Freunde
kennenzulernen. Und es bietet, im Gegensatz zum Film, kein Happy End, auch wenn
man es sich als Leser wirklich ersehnt. Was allein schon ein gewichtiger Grund
für dessen Lektüre ist!